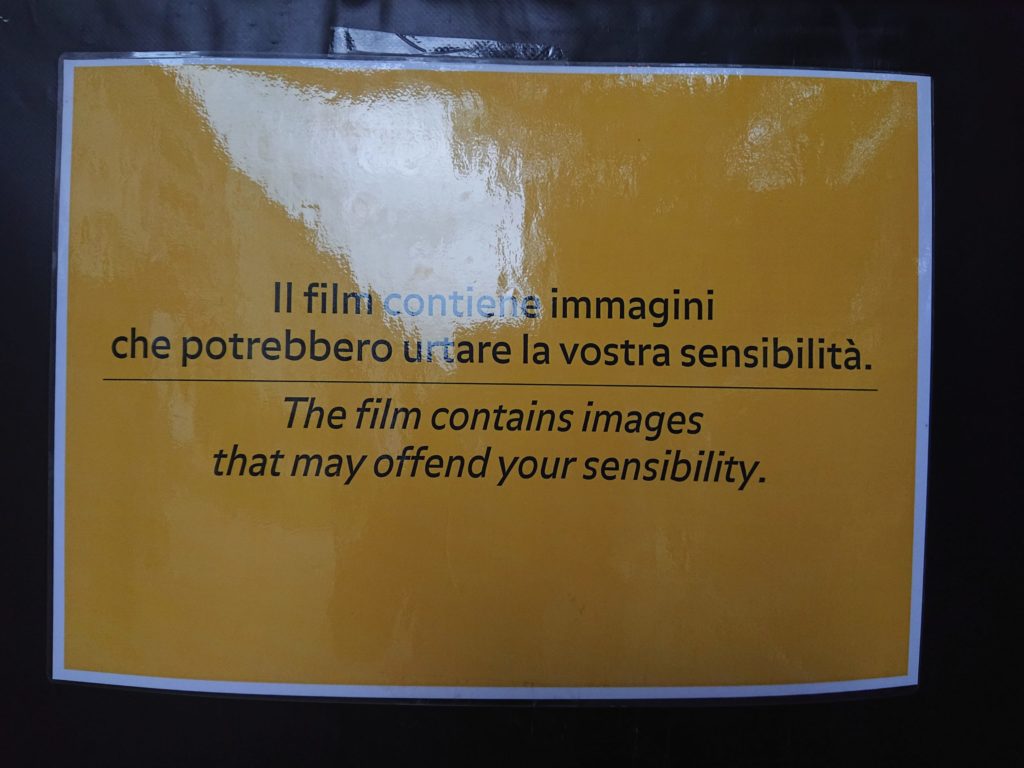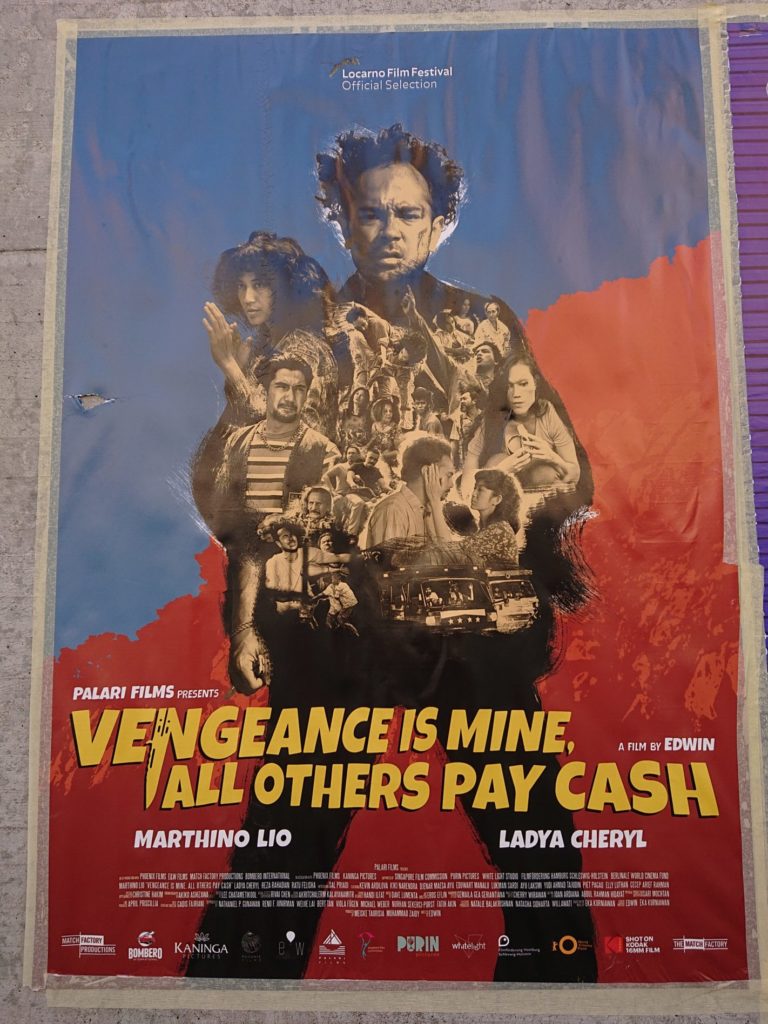Ab-und-zu App
Tatsächlich funktioniert seit heute früh die Festival-App, also vorausgesetzt man findet draussen wirklich stabiles WLAN. Sprich: Die App ist für den Gebrauch nicht wirklich geeignet. In jeder Warteschlange, in jedem Kinosaal unterhalten sich Menschen darüber, wie diese App nicht funktioniert, wie sie teilweise verhindert, dass man gebuchte Vorstellungen besuchen kann. Der Ärger darüber variiert von: Blödsinn bis zu: Wieso bekommen Leute Geld, die so einen Schrott entwickeln.
Dafür ist die Regenwahrscheinlichkeit rechtzeitig zum Wochenende ordentlich gesunken, der Samstag verspricht sonnig und schön zu werden.

Am Eröffnungsabend haben tatsächlich 2.300 Personen auf der Piazza dem Regen getrotzt. Laut künstlerischem Leiter Giona Nazzaro sind bisher fast alle Vorstellungen in Kinos nahezu ausverkauft.
Wasser und Geister
Hao jiu bu jian (Dreaming & Dying) von Nelson Yeo zu verstehen ist nicht ganz einfach.
Die Geschichte mäandert in variablen Kreisen. Zunächst scheint man ein Treffen von Schulfreunden zu sehen. Die Beziehungen der drei scheinen allerdings schwierig: Sie verheiratet mit Ihm, verliebt in den anderen, der wiederum verliebt in ihren Ehemann ist. Und dann ist da noch das Märchen vom Meermann, der, egal wen er liebt, heimwehkrank nach dem Wasser ist, aber unsere zerstörte Umwelt macht jegliche Rückkehr schwierig. Dann gibt es den Fisch, der vom Ehepaar in einer Zeremonie durch den Dschungel ins Wasser getragen werden soll. Aber wer ist der Fisch? Verliebt in den Mann, durch alle Schichten der Zeit gekommen, um diese Liebe einzulösen, oder nur um zu sterben? Und wer ist die Meerfrau? Alles ist mit allem verbunden, das trifft es wohl am besten. Wirklich super sind die sehr grafisch komponierten 4:3 Bilder, die mittels Kamerabewegungen ein neues, anderes Bild der Situation ergeben. Eine eigenwillige Parabel auf die Liebe, die Welt, die Fische, das Meer.
Weitere Geister
Auch in den Kurzfilmen heute tummeln sich diverse Geister.
In Night Shift von Kayije Kagame und Hugo Radi ist das Geisterhafte noch nicht ganz sichtbar. Gäbe es nicht am Anfang eine Tafel, die von der Nachtlampe für die Geister des Theaters berichtet, würde sich das nicht erschliessen. Auch nicht ganz klar ist, warum der Film im sich füllenden Theater beginnt, also alles andere als leer und unheimlich, um dann im nächtlichen Naturkundemuseum zu landen. Hier dreht eine Nachtwächterin ihre Runden, seltsame Geräusche verführen zu Geister-Assoziationen, mehr aber auch nicht. Auf jeden Fall aber sehr schön gedreht.
iNTELLIGENCE von Jeanne Frenkel und Cosme Castro ist da schon expliziter. Der Film lässt Realfiguren auf animiertem Hintergrund agieren und schafft so eine irreale Ebene, die gut zum Thema passt. Eine Firma bietet an, aus persönlichen Erinnerungen einen Geist zu kreieren, der dann nach dem Tod der Erinnernden an die Hinterbliebenen geht. Ein desillusionierter Zeitungsredakteur nimmt das Angebot angesichts seines nahenden, frühen Todes an. Und selbst jetzt, wo er alles, was er fühlt, sagen könnte, schweigt er zu seinen wahren Gedanken, offenbart sich nicht mal für den Geist seiner Erinnerung. Unheimlich.
Scorched Earth von Markela Kontaratou ist eher eine Zombie-Geschichte. In einem Wutanfall tötet ein Mann seine Freundin, die Nachbarin beobachtet das Geschehen. Sie sucht und findet die Stelle, wo die Frau verscharrt wurde, und gräbt sie aus, doch da öffnet diese die Augen.
Pássaro Memória (A Bird Called Memory) von Leonardo Martinelli bietet eher keine Geister, es sei denn, der verlorene Vogel namens Memory ginge als Geist durch. Eine etwas versponnene Geschichte mit Tanzeinlagen, die angeblich von Ausgrenzung erzählt.

Retrokitsch
Die ersten 30, vielleicht 40 Sekunden von Romain de Saint-Blanquats La Morsure sind vielversprechend. Rasanter Schnitt, Bilder, die neugierig machen, die Dramaturgie eines Horrorfilms. Aber dann?
Angesiedelt 1967 – auch wieder ein Trick, um ein altmodisches Frauenbild zu verkaufen? – in einer Klosterschule, in der Françoise, eine 15-Jährige, mit Pendeln und überbordender Phantasie von ihrem nahen Tod zu erahnen glaubt. Alle Bilder, alle Dialoge sind billige Stereotypen von erwachender Sexualität bei einem jungen Mädchen, und das alles völlig humorbefreit. Von Minute zu Minute gräbt sich die Geschichte tiefer in diese altmodischen, kitschigen und überholten Vorstellungen ein. Zu allem Überfluss wird eine Figur, die bis dahin Maurice gerufen wurde, plötzlich als Daniel bezeichnet. Auch das Benzin, dass er aus einem Tank geklaut hat, um sein Moped wieder fahrbereit zu bekommen, bleibt – damit das anfangs erträumte Feuer möglich wird – in den Händen anderer, obwohl er mit dem Moped vermeintlich Hilfe holen ist. Das sind so plumpe Fehler, dass man eigentlich nur lachen kann, geht aber nicht vor lauter Kopfschütteln über den freudschen Retrokitsch.
Schuldfrage
Die Piazza ist am Festival-Samstag eigentlich immer sehr gut besucht, diesmal werden kurz vor Beginn die sich immer noch nachdrängenden Zuschauer nur noch in kleinen Gruppen, und nur nachdem Plätze gezählt wurden, reingelassen. Das klingt eindeutig nach 8.000 Zuschauern. Aber einen Film, der die Goldenen Palme gewonnen hat, gibt es auch nicht oft auf der Piazza.
Anatomie d’une chute von Justine Trie hält, was man sich von ihm verspricht. Er ist spannend, extrem gut erzählt und irre gut gespielt. Was bei diesem Gerichtsdrama, wenn man es so nennen mag, besonders gelungen ist, ist die Ungewissheit, in der der Zuschauer bis zum Schluss bleibt. Alle Möglichkeiten sind offen, alles kann passiert sein. Die einzigen Momente, in denen man wirklich Partei beziehen möchte, sind bei den immer kruder werdenden Aussagen des Staatsanwalts, aber dann wieder: wer weiss? Der Film kam auf der Piazza gut an, wenn auch nicht frenetisch bejubelt. Für einen Publikumspreis braucht es vielleicht doch noch andere Zutaten.

Es gehen auch in diesem Jahr Stühle auf der Piazza zu Bruch.
Manches bleibt verlässlich immer gleich.
Konsequenzen
Bei vormittags schon knallender Sonne auf ins wohl hässlichste Kino des Festivals. L’altra Sala hat den Charme einer Lagerhalle und Sitze noch unbequemer als die Plastikstühle der Piazza. Der Saal ist trotz allem brechend voll.

The Vanishing Soldier von Dani Rosenberg ist ein beeindruckender Film, der in schnellem, fast leichtem Rhythmus Schweres erzählt. Der 18-jährige Shlomi, Soldat in Gaza, verlässt während eines Einsatztes seine Einheit. Ohne auch nur eine Minuten an Konsequenzen zu denken, rennt, springt und duckt er sich erst nach Hause und dann zu seiner Freundin nach Tel Aviv. Und während er noch alles für einen grossen Spass und eine noch grössere Liebeserklärung hält, läuft im Hintergrund der politische Apparat an. Die Armeeführung geht davon aus, dass er entführt wurde, mit allen drastischen Konsequenzen der israelischen Politik. Shlomis Chancen, aus dieser Situation zu kommen, werden immer schlechter, die Reaktionen der Armee werden unterdessen immer härter. Als er sieht, was seine unbedachte Aktion an Leid und Tod nach sich zieht, ist es zu spät, irgendetwas sinnvoll zu ändern. Am Beispiel einer persönlichen Dummheit erzählt die Geschichte das gesamte Dilemma des täglichen Konflikts in Israel.
Rabiat
Eine bunte Mischung, visuell und thematisch, bietet die heutige Ausgabe der Kurzfilme.
Rainer, a Vicious Dog in a Skull Valley von Bertrand Mandico ist ein sehr artifizieller Film. Auf einer Bühne in künstliches Blut und Gedärm getaucht, proben – oder leben – mehrere Darstellerinnen eine krude, weibliche Version von Conan der Barbar. Dazwischen, die hundsköpfige Kriegsphotographin Rainer, eine Dämonin, die einen Pakt vorschlägt, der nicht funktioniert. Sehr bunt, sehr schräg.
O gün bu gündür, uçuyorum (Ever Since, I Have Been Flying) von Aylin Gökmen. Ein Bericht über die Folter von Kurden. Erzählt grösstenteils im Off, zu Bildern kurdischer Landschaft und Menschen, die im Verlauf des Berichts immer mehr verschwimmen und immer abstrakter werden.
Faire un enfant von Eric K. Boulianne zeigt die vielfachen (Fehl)Versuche eines Paars, ein Kind zu machen und dabei ein Paar zu bleiben. Komisch, tragisch und liebevoll.
Der Animationsfilm De Imperio von Alessandro Novelli zeigt Humanoide, irgendwo im Universum, die kleinere, graphische Formen terrorisieren und zerstören. Bis eine neue humanoide Form auftaucht, ein nicht endenwollender Kreislauf. Sehr reduziert gezeichnet und doch schön.

Veränderungen
Sweet Dreams von Ena Sendijarević erzählt von den letzten Wochen einer niederländischen Zuckerplantage in Indonesien um 1900. Als der alte Besitzer stirbt, will sein Sohn nur noch alles los werden und schnellst möglich zurück nach Holland. Die alte Mutter weigert sich, was sie aufgebaut haben, zu verlassen, die indonesischen Arbeiter streiken, und dann ist da noch das uneheliche Kind des alten Besitzers mit einer einheimischen Hausangestellten. In exakt kadrierten, oft achsensymmetrischen 4:3 Bildern entwickelt sich der gesamte Irrsinn einer überholten Zeit. Absolut sehenswert.

Klassiker
Der Sonntag auf der Piazza verspricht: klassisches Drama ins Heute verlegt.
Nichts weniger als Shakespeares Othello hat Regisseur Edoardo Leo dafür ins Jahr 2001 und ins Mafiamillieu verlegt. Das klingt erstmal gar nicht schlecht.
Woran Non sono quello che sono – The Tragedy of Othello di W. Shakespeare krankt, ist vermutlich die Werktreue. Übersteigerte Männlichkeit, Rassismus, mieser Umgang mit Frauen, das alles passt im Prinzip gut zu einer Mafia-Geschichte, aber nicht so. Die Figuren behandeln tatsächlich nur den Shakespeare-Stoff, es gibt keinen wirklichen Hintergrund, in den das alles eingebettet ist, keine Anhaltspunkte, warum die Figuren handeln, wie sie handeln. Und so wird der Originaltext in römischem Dialekt präsentiert, in schönen Bildern, die eine kaputte Welt zeigen, aber zum Teil so unüberlegt und sinnlos hektisch geschnitten sind, dass man die Freude an ihnen verliert. Den Faden der Geschichte hat man da schon lange verloren, und Publikum berühren kann man so auch nicht. Nach dem ersten Drittel sind dann auch relativ viele Zuschauer von der Piazza verschwunden. Schade um die an sich gute Idee.