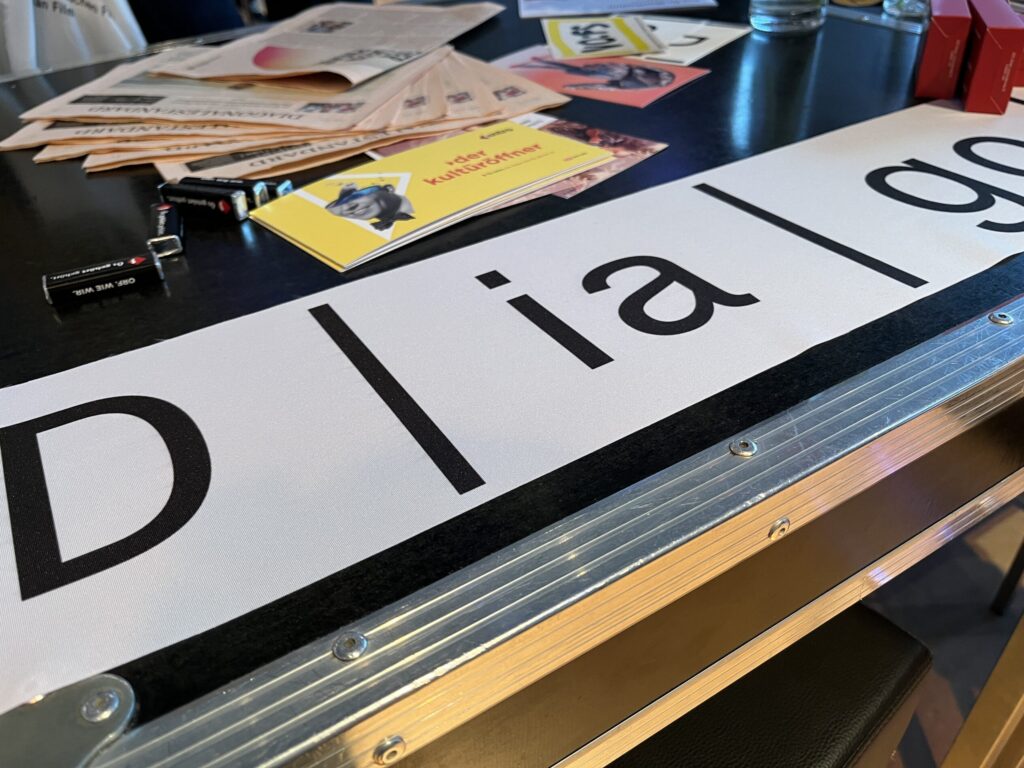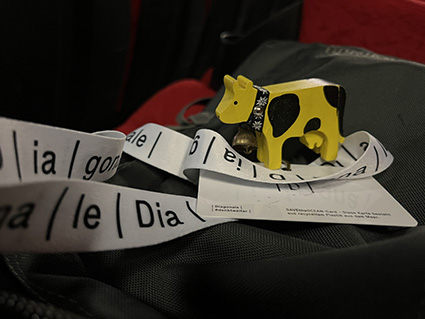
Im Rampenlicht
So ganz scheinen die Intendanten noch nicht in ihrer öffentlichen Rolle angekommen zu sein, zumindest bei den Filmpräsentationen im Kino wirken sie immer noch etwas unsicher. Aber wie alle künstlerisch Verantwortlichen aller Filmfestivals sind die vorgestellten Filme immer ihr Herzenswunsch oder etwas ganz besonders Tolles. Die Filme, die ich bisher gesehen habe, waren tatsächlich durchwegs gut bis sehr gut, regelrechte Enttäuschungen waren noch nicht dabei. Gut gewählt.
Fragen stellen
Besuch im Bubenland von Katrin Schlösser, die gebürtige Leipzigerin erforscht die männliche Seele im Südburgenland. Das klingt zunächst wie ein aussichtsloses Unterfangen, funktioniert aber sehr, sehr gut. Einerseits hat sie wirklich interessante, spezielle Protagonisten, auf die sie sehr offen zugeht, andererseits stellt sie ihre Fragen so geschickt, dass selbst der schweigsamste Typ sich öffnet. Dabei scheint das System ganz leicht: einfache Fragen stellen und dann abwarten, auch schweigend, bis Antworten kommen. Und die kommen, selbst wenn die Männer teilweise sagen, dass sie zu einem Thema nichts sagen werden. Das Warten lohnt sich, die Geduld, und eben die einfachen Fragen. Scheinbar mühelos öffnen sich die Männer, lassen auf ihre Gefühle schauen, und scheinen sich dabei nicht unwohl zu fühlen.
Schlösser dreht mit ihrem Handy und macht den Ton auch selber, kleinstes Team also, mit kleiner Technik. In weiten Phasen des Films funktioniert das gut, schöne Bildkomposition, klarer Ton. Wo die Handykamera an ihre Grenzen stösst, tut sie das allerdings radikal und das macht das Anschauen auf der Leinwand manchmal unangenehm. Schnelle Bewegungen im Bild, zum Beispiel vorbeifliegende Vögel oder herumstiebendes Heu, erzeugen unangenehme digitale Spratzer. Seitlich aus dem Fenster gedreht während Autofahrten macht fast so etwas wie seekrank, und zarte Strukturen im Gegenlicht generieren unschöne visuelle Artefakte. Das alles beiseite genommen, ist der Film rundum gelungen.

Haus – Heim – Zuhause
Das 4. Kurzdokumentarprogramm erforscht ausgiebig den Begriff Haus/Zuhause.
Essayistisch machen das Simona Palmieri, Esther Kreiner und Elisa Cabbai in ihrem Film Stanze / Zimmer. Unter einer Autobahnbrücke am Rand von Bozen hat ein Mann sich eingerichtet. Kunstvoll bemalte Betonpfeiler, Fundstücke, Müll für andere, hat er zu Kunstwerken zusammengestellt. Aber der Mann ist abwesend. Die Suche nach ihm, nach dem Warum, wird auch zu einer Frage nach dem Selbstverständnis, das wir von einem Heim, einem Zuhause haben. Aber muss es immer 4 Wände haben? Reicht vielleicht auch eine Art von Dach über dem Kopf? Oder reicht es vielleicht sogar, sich einen Ort zu eigen zu machen, in dem man ihn liebevoll behandelt?
Einen ganz ähnlichen Ansatz haben Marvin Kanas, Julia Obleitner und Helvijs Savickis in The Desert House. Sie folgen im südlichen Texas den mobilen Fertighäusern, auf riesigen Tieflader gepackt, sind sie „versandfertig“, bereit dort abgestellt zu werden, wo jemand entscheidet wohnen zu wollen. Ebenso schnell fertiggestellt, wie wieder verlassen. Aber sind sie ein Zuhause, oder „nur“ ein Haus? Mit dem europäischen Konzept der Immobilie kommt man da schnell an gedankliche Grenzen. Aber auch in Texas können diese mobilen Heime nicht mehr überall stehen, und so haltbar wie Lehmhäuser sind sie in der rauen Wüste auch nicht, aber auch dort fehlen Fachkräfte. Das Geschäft mit den Fertighäusern boomt.
Was Jan Soldats After Work in dieser Reihe macht, erschliesst sich nicht ganz. Zwei ältere Männer treffen sich – nach der Arbeit – in der Wohnung des einen zum Sex. Ausziehen, kurz absprechen, was gewünscht wird, loslegen. Ob der Sex zwischen den beiden nicht so recht klappen will, weil sie dabei gefilmt werden, man weiss es nicht. Egal. Anziehen, verabschieden, fertig. Schneller Sex in einem Zuhause, vielleicht ist das der gedankliche Zusammenhang gewesen.
Böse
Veni Vidi Vici von Daniel Hoesl und Julia Niema ist eine zynisch-bitterböse Geschichte in schönen Hochglanzbildern. Ein schnöseliger Multimillionär, der zur Entspannung auf Menschenjagd geht. Einfach so, weil er es kann. Weil ihn niemand daran hindert, obwohl es völlig offensichtlich ist, dass er für die Morde verantwortlich ist. Die Verstrickungen aus (viel) Geld, Macht, Politik, Medien und Justiz ermöglichen es ihm und seiner Familie, mit allem durchzukommen, nicht nur mit willkürlichen Morden. Dabei sind alle stets freundlich, lächelnd, wirken engagiert, ihr Blick auf den Rest der Gesellschaft ist allerdings von zynischer Ekelhaftigkeit geprägt. Sie verachten die Anderen dafür, dass sie alles zulassen, nicht aufschreien, sich nicht wehren, das Offensichtliche nicht stoppen. Und die nächste Generation hat gelernt und steht schon bereit. Ein politisches Lehrstück in Form einer bitterbösen Geschichte.

Körper
Corpus Homini von Anatol Bogendorfer zeigt die Arbeit am menschlichen Körper, eigentlich die Arbeit für den Menschen. Parallel zeigt er den Alltag eines Bestatter-Paares, einer Sexarbeiterin mit Zusatzausbildung für Sexarbeit mit körperlich oder geistig eingeschränkten Menschen, einer Hebamme und einer Hausärztin. Der Film nähert sich den einzelnen Frauen und ihrer Arbeit sehr behutsam, und führt so die Zuschauer stückweise näher und tiefer in die Materie ein. Durch das langsame Herantasten entsteht ein grosses Verständnis für den Kern der Arbeit am und für den Menschen, man versteht, wie viel Kommunikation in allen vier Berufen nötig ist. Die Dramaturgie, die die Intensität der Arbeit immer weiter offenlegt, erzeugt dabei zusätzlich Spannung, und ist trotzdem nie voyeuristisch oder würdelos. Obendrein kommt der Film nicht nur ohne Kommentar, sondern auch ohne redende Köpfe aus! Ein toller Film, der sehr gut ankam und in einer angeregten Publikumsdiskussion endete.
Morgen Abend werden, bis auf den Publikumspreis, alle Preise vergeben, eine Spekulation, was den Jurys gefallen haben könnte, ist eher nicht möglich.